
„Mehr Raum für alle!“
Architekt Wolfgang Thanel
über das Bauprojekt im Sonnenpark St. Pölten
Ein Bauprojekt für die Freie Szene stellt Architekten durchaus vor Herausforderungen. Es gilt viele Interessen zu berücksichtigen und aus begrenzten finanziellen Ressourcen das Bestmögliche herauszuholen. Ständig auf dem Sprung und dazu noch notorisch kameraschau haben wir es geschafft, unseren Architekten Wolfgang Thanel zum Gespräch abzupassen. Im Solektiv-Interview berichtet er über den kreativen Prozess bei der Planung und die neuen Nutzungsmöglichkeiten, die sich in Zukunft dem Publikum und den Künstler:innen am Standort eröffnen.

Der Erfolg des Projekts hängt ganz maßgeblich von der engen Zusammenarbeit mit den zukünftigen Nutzer:innen ab.
Lieber Wolfgang, die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Wie verändert sich der Sonnenpark gerade durch den Umbau?
Wolfgang Thanel: Das Hauptziel war es, Räume und Raumgruppen zu schaffen bzw. in den Bestand zu integrieren, die funktional und nutzungsflexibel sind. Dabei war es wichtig, dass der historische Charme des Gebäudes spürbar bleibt. Ein besonderer Fokus lag von Anfang an auf der partizipativen Einbindung der Vereinsmitglieder.
Warum war die Einbindung der Vereinsmitglieder so wichtig?
Wolfgang Thanel: Wir haben bewusst einen offenen Prozess gewählt, in dem die Mitglieder des Vereins und Interessierte aktiv mitgestalten konnten. Anfang 2019 haben wir mehrere Workshops organisiert und Mitglieder und Interessierte eingeladen, sich am Diskussionsprozess zur Zukunft der Gebäude zu beteiligen. Diese Workshops waren die Grundlage für die weitere Planung und haben den kreativen Austausch zwischen den Nutzer:innen der Räume gefördert. Es war uns wichtig, dass jedes Mitglied die Gelegenheit hatte, seine/ihre Perspektive einzubringen.



Auf Achse: Architekt Wolfgang Thanel auf einer Wiener Rolltreppe © Dirk Novy
Wie habt ihr die Workshops angelegt?
Wolfgang Thanel: Die Workshopreihe – „Raumdings“ – waren der kreative Katalysator für die gesamte Planung. Initiiert von Agnes Peschta [Präsidentin Solektiv, red] ging es dabei nicht um architektonische oder technische Details, sondern vor allem um die Atmosphäre des Ortes. Wir haben uns darauf konzentriert, welche Situationen, Stimmungen und Gefühle der Raum vermitteln soll. Dieser Zugang hat auch das Unkonkrete, offene Assoziationen und subjektive Wahrnehmungen zugelassen.

Luise Ogrisek bei der Gestaltung eines Workshops © Solektiv
Ein Raum für die Gemeinschaft und das kreative Zusammenarbeiten
Was hast Du aus diesem Kontakt mit den Mitgliedern mitgenommen?
Wolfgang Thanel: Besonders wertvoll war, dass durch die Workshops und den Austausch mit den Vereinsmitgliedern ein starkes Miteinander entstanden ist. Es wurden Ideen entwickelt, wie die Räume nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für gemeinschaftliche Nutzung und kreative Zusammenkünfte funktionieren sollten. Wir haben dabei mit verschiedenen Workshopformaten experimentiert.

Image Emotion: Die Teilnehmer:innen waren eingeladen bis zu drei Bilder einsenden, die ihre emotionale Verbindung oder Vorstellung vom Ort ausdrücken. Diese visuellen Beiträge wurden – ähnlich wie bei SocialMedia mit Likes – bewertet und konnten mit kurzen Statements versehen werden, sodass ein breites Spektrum an Assoziationen und Ideen gesammelt werden konnte. Schließlich wurden sie nach Wertigkeit und Themenästen geordnet.
© Wolfgang Thanel
Was ist dabei rausgekommen?
Wolfgang Thanel: Der Fokus lag darauf, die Räume so zu gestalten, dass sie verschiedene Nutzungen und Bedürfnisse abdecken können. Die Ideen aus diesem demokratischen Prozess flossen in die Gestaltung ein und wurden zu einem entscheidenden Bestandteil des gesamten Renovierungsprojekts. Flexibilität ist der Schlüssel. Wir mussten die Räume so gestalten, dass sie sowohl für Kunst und Kultur als auch für andere Formen der sozialen Begegnung geeignet sind.

Wolfgang Thanel im Workshop mit Vereinsmitgliedern: Wo wollen wir renovieren, welche Räume sind uns besonders wichtig? © Solektiv
„Emotionaler Denkmalschutz“ und Zukunftsperspektiven
Wie seid ihr bei der Planung mit historischen Elementen umgegangen?
Wolfgang Thanel: Von Anfang an war klar, dass die Substanz weitgehend erhalten bleiben sollte, um die Atmosphäre des Ortes und seine Geschichte zu wahren; wir sprachen in diesem Zusammenhang von „emotionalem Denkmalschutz“. In den Workshops wurde der Wunsch geäußert, möglichst wenig an der Struktur zu verändern und gewachsene Abläufe zu berücksichtigen. Wichtige Funktionen – Weißer Saal, Hofbar, etc. – sollten unbedingt ins Konzept integriert werden. Erhaltenswertes, wie zum Beispiel der Terrazzo im Erdgeschoß, sollte erhalten bleiben.
Wie ging es nach den Workshops 2019 weiter?
Wolfgang Thanel: Nach dem partizipativen Prozess, ging es darum, die Visionen zu konkretisieren. Ende 2019 hat sich eine kleine Runde (Serena Laker, Andi Fränzl, Roland Ruhm, Agnes Peschta, Mine Bayazit & Wolfgang Thanel) für eine zweitägige Arbeitsklausur ins Hotel Villa Berging zurückgezogen, um am zukünftigen Nutzungskonzept weiterzuarbeiten.
Ergebnis war das Nutzungskonzept, oder?
Ja, genau. Das Nutzungskonzept war ein entscheidendes Dokument für die Verhandlungen zur Baufinanzierung. Besonders herausfordernd war, dass die Bewerbung von St. Pölten als Europäische Kulturhauptstadt scheiterte und die tatsächliche Höhe der Fördermittel somit fraglich war. Anfangs standen lediglich 400.000 Euro zur Verfügung – weit weniger als die tatsächlich benötigte Summe. In intensiven Diskussionen wurden daher Prioritäten gesetzt: Von essenziellen Baumaßnahmen wie Fundament, Dach, Haustechnik und Fenstern bis hin zu einem gewünschten Szenario, das auch neue, vielseitig nutzbare Flächen vorsah. Zu diesem Zeitpunkt wurden die gewünschten Raumgruppen bereits klarer definiert und die Nutzungsmöglichkeiten für bestimmte Gebäudeabschnitte besprochen.
Studierende der TU Wien packen mit an!
Wie war die TU Wien in das Projekt eingebunden?
Wolfgang Thanel: Im Sinne eines möglichst breit aufgestellten Planungsprozesses entstand die Idee, in einem nächsten Schritt das design.build studio der TU Wien mit Peter Fattinger zu einer Kooperation einzuladen. Im Rahmen der zweisemestrigen Lehrveranstaltung, die ich 2020/21 gemeinsam mit Peter Fattinger leiten durfte, haben wir mit den Studierenden und den Mitgliedern die bereits definierten Ideen noch einmal hinterfragt.
Was haben die Studierenden genau gemacht?
Die Aufgabe der Studierenden war es, Visionen für das gesamte Areal zu formulieren und kreative sowie praktikable Lösungen für Räume bzw. Raumgruppen zu entwickeln. Anschließend wurden einzelne Bereiche im 1:1-Modell umgesetzt, wie zum Beispiel im „Schwarzen Raum“ im Haus 83 oder die ersten baulichen Maßnahmen im „Weißen Saal“.

Studierende im Design-ProzessIm design.build studio der Technischen Universität Wien durchlaufen Studierende alle Phasen eines Architekturprojekts, von der Idee bis zur praktischen Umsetzung, und lernen, als Team mit planerischen und bautechnischen Herausforderungen umzugehen. Der integrative Ansatz, bei dem Entwurf und Bauprozess parallel entwickelt werden, fördert praxisrelevante Handlungskompetenzen und ermöglicht den Studierenden, die direkten Auswirkungen ihres Handelns in einem realen Kontext zu erfahren. © Solektiv
Nachhaltigkeit – baulich, künstlerisch, sozial
Ganz anderes Thema: Welchen Stellenwert hatte denn Nachhaltigkeit bei euren Planungen und dem Bauprojekt insgesamt?
Wolfgang Thanel: Nachhaltigkeit ist für uns ein zentrales Thema. Wir wollten viel von der bestehenden Substanz erhalten, da diese nicht nur emotional, sondern auch im Sinne der bereits verbauten Ressourcen – graue Energie – relevant ist. Bei den neu verbauten Materialien haben wir auf Nachhaltigkeit geachtet: Alle neuen Volumina wurden mit nachwachsenden Rohstoffen im Holzbau konzipiert. Zudem haben wir eine CO2-neutrale Wasser/Wasserwärmepumpe geplant, mit der die Räume beheizt werden. Auch der Wunsch, Materialien wiederzuverwenden bzw. upzucyclen, wurde berücksichtigt.
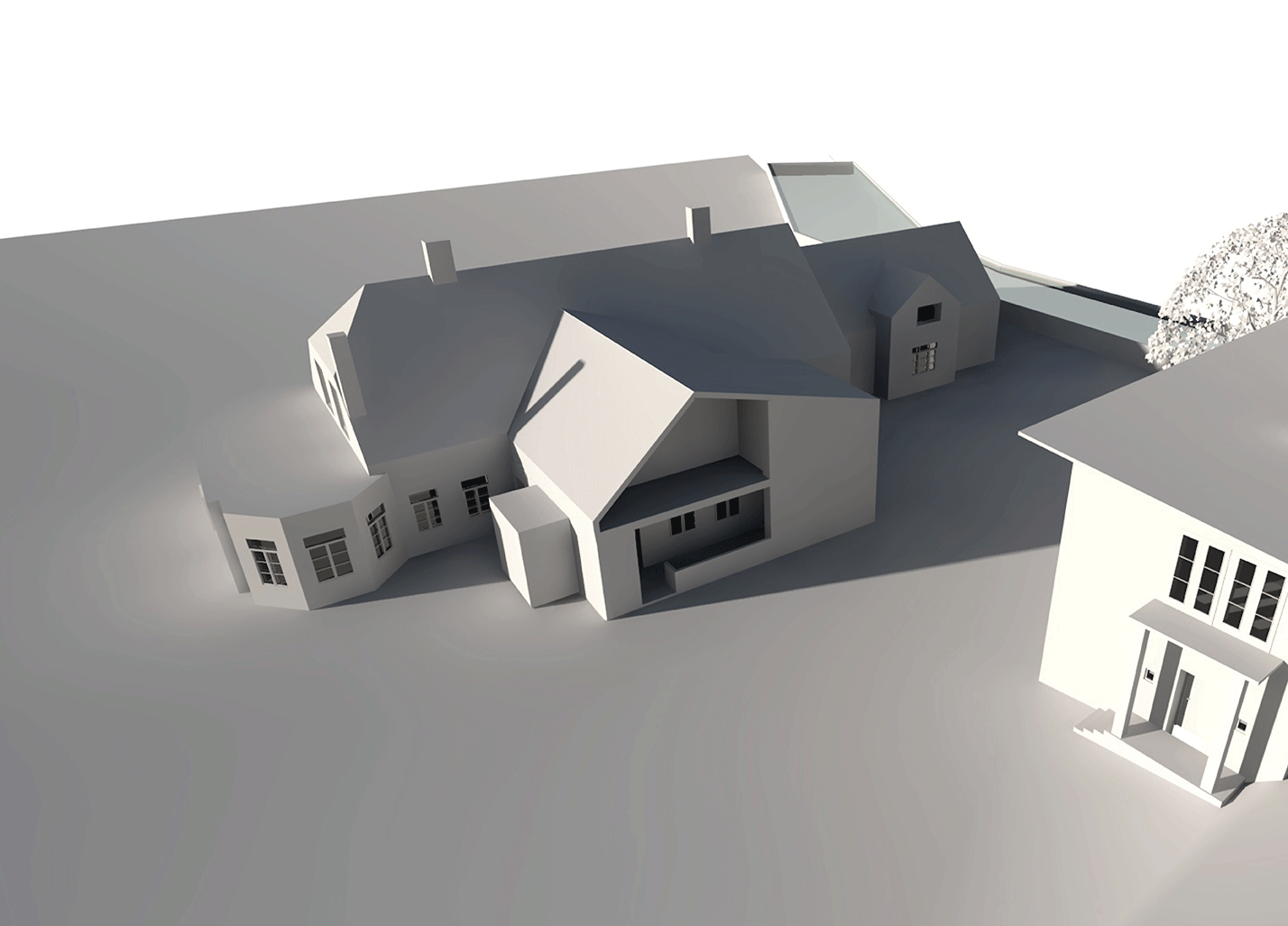
3D-Visualisierung des Haupthauses am Spratzerner Kirchenweg 81 © Wolfgang Thanel
Was wär denn so dein Wunsch für die Zukunft des Sonnenparks?
Wolfgang Thanel: Ich hoffe, dass wir das Projekt ohne größere Unterbrechungen fertigstellen können. Besonders der Innenausbau des Dachgeschosses mit dem zusätzlichen Multifunktionsraum würde viele neue Möglichkeiten eröffnen. Was ich mir wünsche, ist eine stabile Förderung, die es dem Verein ermöglicht, den Sonnenpark langfristig weiterzuentwickeln. Es geht darum, einen Ort zu schaffen, der nachhaltig wirkt und langfristig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat. Es ist entscheidend, dass die Räume aktiv genutzt werden können, um kulturelle Veränderungen zu realisieren. Die Räume müssen mit den gesellschaftlichen Transformationen wachsen. Der Sonnenpark soll ein Ort sein, an dem solche Veränderungen stattfinden können.

Visualisierung des Haupthauses zum Open House 2025 © Wolfgang Thanel
... und außerhalb des Sonnenparks
Welche Projekte im Kulturbereich begleitest du derzeit noch / bzw. welche waren in der Vergangenheit für dich von Bedeutung?
Lange Zeit hat mich die Kulturinitiative halle2 in Wieselburg/NÖ begleitet, die ich 1998 mit Anton Bauer und Werenfried Ressl gegründet habe. Unser Bestreben war, im Bespielen und Sichtbarmachen kaum genutzter Orte Impulse zu setzen und stadträumliche Veränderungen herbeizuführen. Wurden unserer Ideen anfangs noch kontroversiell aufgenommen oder milde belächelt, ist manches — wie die kulturelle Nutzung des Schlossparks — mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Auch die Neugestaltung des Bereichs rund um den Zusammenfluss von Kleiner und Großer Erlauf — früher nur zu Messezeiten genutzt — wurde zum Teil realisiert. Eine zentrale Liegenschaft am Flussufer wurde 2021 seitens der Gemeinde erworben und vor kurzem den Themen Kultur und Begegnung gewidmet. Die Ideen zur Transformation des Stadtraumes wurden also Teil der Ortsentwicklung. Die namensgebende „Halle 2“ wird zwar als Gebäude verschwinden, aber ich bin zuversichtlich, dass die Vision auch unter geänderten Voraussetzungen nicht aus den Augen verloren wird.
Der Impuls Kultur im stadträumlichen Kontext zieht sich wie ein roter Faden durch meine Tätigkeit. Auch meine eigenen künstlerischen Arbeiten an der Schnittstelle zur Architektur sehe ich als Vermittler und Beziehungshersteller.
Gemeinsam mit der Lektorin, Autorin und Literaturvermittlerin Evelyn Bubich plane und kuratiere ich zudem 2025 das Kinderliteraturprogramm „Geschichtenkiste", das heuer zum Sommerbeginn erstmals in Wien stattfindet. Die Veranstaltungsreihe dialog:erinnern, die eine Brücke zwischen historischen Geschehnissen, zeitgenössischer Kultur und dem Publikum spannt soll ebenfalls weitergeführt werden.
Lieber Wolfgang, vielen Dank für das Gespräch! (Solektiv, 2025)